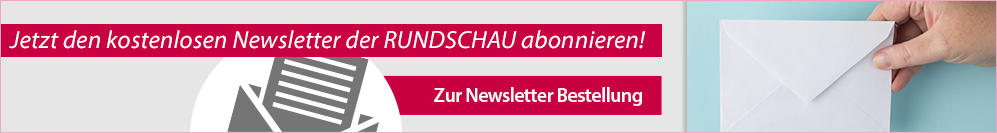Herr Grünewald, in der von Ihnen durchgeführten Nestlé-Studie „So is(s)t Deutschland 2024“ werden die Sehnsucht nach Unbeschwertheit und das Spannungsfeld zwischen Verzicht und Genuss tiefenpsychologisch beleuchtet. Was hat sich im Ernährungsverhalten der Deutschen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit verändert?
Die Menschen erleben im Grunde seit einigen Jahren eine Vertreibung aus dem Ernährungsparadies. Die vor allem durch die Coronakrise erzeugte gesteigerte Selbstbezüglichkeit bedeutet ja, dass Ernährungsideale heute stärker privatisiert werden, was wiederum einen erhöhten Druck zur Folge hat, diesen selbst gesteckten Idealen gerecht zu werden. Unsere Studie hat ergeben, dass 89 Prozent der Befragten mit mindestens einem Aspekt der eigenen Ernährung unzufrieden sind, bei der Generation Z sind es sogar 96 Prozent.
Wie konnte es eigentlich so weit kommen?
Nach dem Krieg herrschte erst mal ein verschwenderischer Umgang mit Lebensmitteln, man genoss das Essen in vollen Zügen. In den 1960er-Jahren folgten Mäßigungs- und Schlankheitsideale, in den 1970ern der Gesundheitshype und in den 1980ern die Forderungen nach Selbstoptimierung. Nach der Jahrtausendwende kamen zunehmend Moralvorstellungen mit Klimaschutz- und Tierwohlaspekten hinzu.
Themen, die insbesondere junge Menschen triggern, oder?
Absolut. Und bei dieser Zielgruppe kommt noch ein weiterer Anspruch hinzu: Wir bezeichnen ihn als „Ess-Thetisierung“. Das bedeutet, dass jede Mahlzeit vor dem Verzehr noch besonders schön drapiert wird, damit sie in den sozialen Medien auch optimal gepostet werden kann.
Sie formulieren in der Studie Konsequenzen, die den Konsumenten drohen, wenn sie sich nicht richtig ernähren. Welche sind das?
Wir haben die Folgen einer unvernünftigen Ernährung unter sieben „Plagen“ zusammengefasst. Dazu zählen Gewichtszunahme, Demenz, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Leistungsschwäche, Verdauungsstörungen und früher Tod.
Das sind Themen, die durchaus abschrecken können. Welche Strategien verfolgen die Menschen, um sich davon frei zu machen?
Um aus dieser babylonisch anmutenden Ernährungsverwirrung herauszukommen, finden die Bürger ihre eigenen Wege. Zur Wiedererlangung der Unbeschwertheit werden vier unterschiedliche Strategien verfolgt. Eine davon ist, dies über Mäßigung zu erreichen, mit sorgfältiger Einkaufsplanung, Verzicht auf Fleisch und möglichst wenig Verpackung. Die entgegengesetzte Strategie wäre der Retro-Trend, bei dem man sich in die vermeintlich „gute alte Zeit“ zurückversetzt und vor allem den Fleischkonsum ungebremst weiter zelebrieren will.
Einen anderer Weg stellt ein neuer Pragmatismus dar, bei dem die Menschen ihre Ernährung pragmatisch angehen und sich vom ideellen Ballast befreien. Dabei kocht fast die Hälfte lieber einfache Gerichte, insbesondere die jüngere Gen Z nutzt verstärkt Lieferdienste. Die vierte Strategie ist der verdeckte Genuss im Nebenbei. Mit einem beiläufigen Dauer-Snacking wird das bewusste Radar unterlaufen, wodurch Gefühle von Schuld und Scham gar nicht erst aufkommen können. Beim Nebenbei-
Konsum sind die Ansprüche der Verbraucher an sich selbst viel geringer als bei konventionellen Mahlzeiten.
Welche Rolle könnten Politik und Handel dabei einnehmen?
Die Politik muss klar sagen, was geht und was nicht. Ein Verbot ist manchmal entlastender als ein Gebot. Der LEH wiederum sollte beim Sortiment eine sorgfältige Vorauswahl treffen und Shoppern damit vermitteln, dass sie – wofür auch immer sie sich entscheiden – auf der sicheren Seite sind. Damit würden Zweifel, Schamgefühle et cetera ausgeräumt, und eine neue Unbeschwertheit könnte entstehen.
Stephan Grünewald
Der Psychologe und Autor leitet das Rheingold Institut. Hier wechselt er sich mit David Bosshart, Florian Klaus und Martin Fassnacht ab. www.stephangruenewald.de