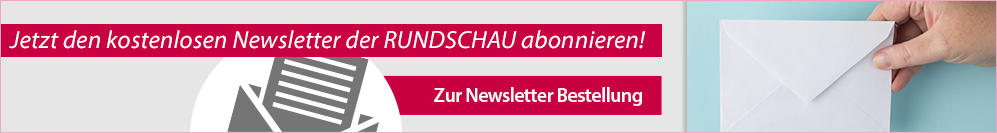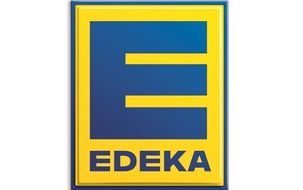Welche Themen haben Sie seit ihrer Wahl zum BVLH-Präsidenten 2023 gut auf den Weg bringen können?
Zunächst habe ich viel zugehört: Was bewegt die Mitgliedschaft, was bewegt die Politik und was bewegt auch andere Akteure in der Branche. Welche Themen spielen für den Mittelstand, die genossenschaftlich geprägten Betriebe genauso wie für die großen Filialbetriebe eine Rolle und was bewegt die Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende der Wertschöpfungskette. Und besonders relevant ist die Frage: Was macht die Politik daraus? Denn ich glaube, wir haben es noch nicht gut genug geschafft, unsere Leistungen als Lebensmittelhandel konkret darzustellen.