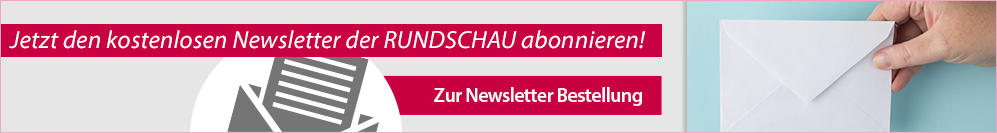Kultiviertes Fleisch – der Begriff ist noch vielen unbekannt. Dabei handelt es sich um eine Innovation mit Potenzial. Dieses Fleisch wird in einem Bioreaktor aus tierischen Zellen produziert. Einem Tier wird dafür eine kleine Gewebeprobe entnommen, die im Labor auf diejenigen Zellen hin untersucht wird, die sich für das Vorhaben am besten eignen. Diese werden zu Zelllinien gezüchtet, in denen sich die einzelnen Zellen – wie sonst im tierischen Organismus auch, aber nun eben außerhalb des Körpers – gut vermehren und weiter wachsen können. Gibt man diese Zellen in einen Fermenter (Bioreaktor) und setzt bei geeigneter Temperatur das passende Nährmedium zu, können sie sich – auch in großem Maßstab – vermehren. Abhängig von den genauen Fermentationsbedingungen lässt sich zudem steuern, welche Zelltypen entstehen (etwa Fett- oder Muskelzellen). Sobald ausreichende Fleischmengen entstanden sind, kann man diese entnehmen und weiter verarbeiten.
Orte der Innovation: Alternative Proteinquellen
Immer mehr Menschen hinterfragen ihren bisherigen Fleischkonsum, das zeigt die wachsende Zahl der Flexitarier und Vegetarier. Im Supermarkt-Regal wird daher gerne zu Proteinen pflanzlichen Ursprungs gegriffen. In Zukunft könnte auch kultiviertes Fleisch verstärkt in den Blickpunkt rücken.

Von vielfältiger Relevanz
Die Vorteile dieses Verfahrens gegenüber der heutigen Tierhaltung? Treibhausgase, Flächenbedarf und Luftverschmutzung lassen sich beispielsweise reduzieren. Sich von den Auswirkungen anfälliger Lieferketten, des Klimawandels oder kriegerischer Konflikte unabhängiger zu machen, trägt zudem zur Ernährungssicherheit bei. Die Gefahr von Pandemien (Vogelgrippe, Schweinepest), lebensmittelbedingten Erkrankungen (etwa durch Salmonellen) und ein übermäßiger Einsatz von Medikamenten wie Antibiotika ließen sich vermeiden. Tiere müssten nicht mehr in gleichem Ausmaß wie derzeit geschlachtet werden.
Zahlreiche Start-ups widmen sich entsprechenden Verfahren. 2013 präsentierte das niederländische Unternehmen Mosa Meat den ersten aus kultivierten Stammzellen entwickelten Rindfleisch-Burger. Seither tüftelt es daran, die Kosten von kultiviertem Fleisch zu senken, den Geschmack zu optimieren und die Produktion skalierbar zu machen. Auch etablierte Firmen der Lebensmittelindustrie investieren in diesen Bereich. So arbeitet etwa die PHW-Gruppe mit Mosa Meat zusammen und kooperiert auch mit SuperMeat aus Israel.
Der Ernährungsmix der Zukunft
„Wir sehen Cultivated Meat als eine vielversprechende Innovation, die langfristig helfen kann, Ressourcen effizient zu nutzen und gleichzeitig hochwertige tierische Proteine verfügbar zu machen – ohne Schlachtung“, erläutert Dr. Ingo Stryck, Leiter Marketing der PHW-Gruppe in Visbek, Niedersachsen. „Diese Technologie steckt zwar noch in den Anfängen, doch sie bietet in Ergänzung zu den bestehenden Proteinquellen Potenzial für bestimmte Märkte und Zielgruppen.“ Als Teil einer langfristigen Innovations- und Diversifizierungsstrategie investiere man daher in Forschung, Start-up-Kooperationen und Inhouse Kompetenzzentren, um flexibel auf unterschiedliche Szenarien reagieren zu können. Kultiviertes Fleisch betrachtet Stryck jedoch nicht als alleinige Lösung: „Die pflanzlichen Produkte werden weiterhin die dominante Rolle im Markt der alternativen Proteine einnehmen.“ Und so stehen auch andere Technologien wie die Präzisionsfermentation oder neue Entwicklungen innerhalb der Pflanzenbiotechnologie ebenfalls im Blickpunkt.
Stryck verdeutlicht, dass die Technologie bei kultiviertem Fleisch zwar voranschreitet, sich aber immer noch in der Entwicklungsphase befindet. „Gleichzeitig sind die regulatorischen Prozesse in der EU (Novel Food) inzwischen im Gange.“ Er rechnet jedoch frühestens ab 2026/27 mit ersten Marktzulassungen – zunächst bei Pilotprojekten. Eine breite Verfügbarkeit im Lebensmittelhandel hält er eher im nächsten Jahrzehnt für realistisch – abhängig von Produktionskapazitäten, der Preisentwicklung und regulatorischen Freigaben.