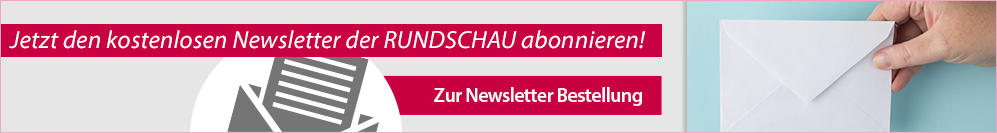Was ist der Wert von Innovationen für die Lebensmittelbranche?
Mit Innovationen können die Bedürfnisse der Shopper besser befriedigt werden – einschließlich jener Bedürfnisse, von denen die Konsumenten noch gar nicht wissen, dass sie sie überhaupt haben. Zudem findet das Wachstum für Industrie und Handel zum größten Teil über Innovationen und neue Produkte statt.
Was gilt überhaupt als Innovation?
Ich finde zunächst die umgekehrte Frage interessant, was keine Innovation ist – zum Beispiel, wenn ein Produkt in einer kleineren Verpackung angeboten wird. Oder wenn Produkte einfach kopiert werden. Bei echten Innovationen geht es vor allem darum, über neue oder signifikant verbesserte Produkte einen Mehrwert für die Konsumenten zu generieren. Allerdings stellt nicht jede Innovation einer Marke auch eine Innovation für die Kategorie dar.
Sollten Innovationen grundsätzlich auf einen Trend einzahlen?
Man muss zwischen Trend und Hype unterscheiden. Ein Hype flacht sehr schnell ab, ein gutes Beispiel dafür ist die Dubai-Schokolade. Trends sind nachhaltiger, setzen sich über Jahre fort – und erfolgreiche Innovationen zahlen meistens auf mehr als einen Trend ein. Allerdings verläuft ein Trend nicht immer linear, sondern bewegt sich auch eine Zeit lang seitwärts. Das sehen wir beispielsweise bei Milch- und Fleischersatz. Sie liegen zwar nach wie vor im Trend der Verbraucher, es findet aber gerade eine Konsolidierung der Nachfrage statt, mit weniger Wachstum als am Anfang. Dennoch sind beides Kategorien, die in ihrer Bedeutung weiterhin an Relevanz gewinnen werden.
Gibt es Produktkategorien, die innovationsaffiner sind als andere?
Es gibt Kategorien, bei denen es vielleicht einfacher ist, einen Mehrwert für den Konsumenten zu erzielen. Doch grundsätzlich sind Innovationen in jeder Kategorie möglich. Bei Teigwaren zum Beispiel konnte durch den Einsatz einer Bronzeform eine aufgeraute Oberfläche erzeugt werden, die zu einer besseren Aufnahme von Saucen führt. Oder wer hätte der Kategorie Waschmittel so viel Innovation bei Verpackung und Portionierung zugetraut?
Innovation findet oft bei Start-ups statt. Tun sich größere Markenhersteller schwerer damit?
Start-ups können viel experimentieren, bei größeren Unternehmen ist das Risiko auch größer, genauso wie die Kostenstruktur und der Kapitalbedarf. Auch sind dort die Entscheidungsprozesse manchmal etwas länger. Deswegen werden Start-ups häufiger als innovativ wahrgenommen, aber es gibt auch sehr erfolgreiche große innovative Player.
Übrigens haben wir festgestellt, dass Innovationen wichtig für das Marken-, aber auch Kategoriewachstum sind. So unterscheiden sich die wachstumsstärksten Marken und Kategorien in der Anzahl der Neuprodukte. Spannend dabei: Für große Marken ist im Vergleich zu kleineren Marken das Kategoriewachstum wichtiger als Marktanteilsgewinne. Wenn also meine Kategorie durch Innovationen wächst, wachse ich auch als Hersteller. Grundsätzlich brauchen also auch große Markenhersteller Innovation, um zu wachsen. Sie müssen aber eine passende Balance zwischen bestehendem Portfolio und spannenden Neuheiten finden, die die Glaubwürdigkeit der Marke nicht gefährden. Es braucht Mut dazu. Aber ohne Mut kein Wachstum.
Am Ende muss der Handel die Innovationen ins Regal stellen. Der Platz ist aber begrenzt. Wie kann der LEH Innovationen fördern?
Eine Möglichkeit ist über die Schaffung von entsprechenden Verkaufsflächen. Innovationen brauchen Sichtbarkeit, und dies kann über Zweitplatzierungen oder speziellen Gondelköpfen passieren. Häufig verlieren Innovationen bei der Sortimentsvielfalt im Stammregal ihre Sichtbarkeit. Selbstständige Kaufleute spielen hierbei in meinen Augen eine besondere Rolle. Ein anderer interessanter Weg ist über die Zentralen, wo es beispielsweise bei Rewe über das Innovation Hub mittlerweile auch für Start-ups die Möglichkeit gibt, Listungen zu generieren und so Innovationen schneller auf den Markt zu bringen.